Der Verlag:

Unser Tipp:
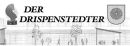
Unterstützer für die Webversion:

Anzeigenpreise für die Druckversion:
Anzeigenpreise
Schloss Meyen vormals die Pippelsburg
„Eine kleine Pippelsburg“ nannte Moritz vom Berge im September 2008 den Neubau der GBG an der Ecke Maschstraße / Pippelsburg. Die Straße „Pippelsburg“ erhielt 1923 als neue Verlängerung der Maschstraße ihren Namen. Worauf bezieht er sich? Gab es eine Pippelsburg?
In den ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts stritt die Stadt Hildesheim mit dem Michaeliskloster um die Eigentumsrechte an den Wiesen zwischen Hildesheim, Moritzberg und Himmelsthür.1 Wohl in diesem Zusammenhang entstand 1721 eine Karte, eine „Geometrische Vorstellung der quaestionierten Wiesen vor Hildesheim“, die im Niedersächsischen Hauptstaatsarchiv Hannover aufbewahrt wird.2 Sie zeigt den alten Verlauf von Kupferstrang und Innerste zwischen der Bergmühle (später „Gummifabrik“) und Himmelsthür. In einer U-förmigen Windung des Kupferstrangs bezeichnet eine Markierung auf der Karte einen „Pippel-Kolck wo ein Schloß gelegen haben solle“. Nah dabei ist bachaufwärts eine Stelle markiert, „wo vor diesem die Bergmühle gelegen haben solle“. Ein Kolk ist eine Ausweitung des Flussbettes. Er wurde üblicherweise unterhalb eines Wehrs angelegt, das den Wasserzulauf zu einer Wassermühle regulierte. – Und das „Schloss“? Eine Anspielung auf die „Pippelsburg“?
Heinrich Kloppenburg, der sorgfältige Chronist der Moritzberger Geschichte, hat 1933 über die „Pippelsburg“ vermerkt: „Diese lag am Fuße des Krehlaberges, wo noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts der Pippelkolk sich befand. Aus dem letzteren Namen ist zu schließen, daß die Pippelsburg eine eigene Mühle besaß. Die Zeit der Erbauung der Pippelburg ist nicht nachzuweisen, doch hält man sie für eine der ältesten Ansiedlungen in der hiesigen Gegend. Später erbaute sich ein Hildesheimer Bischof hier ein Schloß, das bei der Zerstörung der Dammstadt 1332 von den Hildesheimern zerstört wurde .... Bei Anlage der Hafenbahn fand man behauene Quadersteine, die man für Reste der alten Pippelburg hielt.“3

– Eine Burg, ein Schloss und eine Mühle, für die wir keine weiteren Belege haben? Der „Pippelkolk“ ist auf der Karte von 1721 und anderen Karten des frühen 18. Jahrhunderts bestätigt. Eine ältere Karte im Stadtarchiv Hildesheim, zur Klärung von Streitfragen um 1685 gezeichnet, zeigt in Farbe die ehemalige Dammstadt nördlich des Bergsteinwegs.4 Die Häuser der Dammstadt reichen auf dieser Karte über die Schützenwiese hinaus bis an die Innerste jenseits der heutigen B 1. In der Nordwest-Ecke der bebauten Fläche ist eine Burg mit Turm eingezeichnet und als „das alte Schloß Meyen“ und „Meyenborg alias Pippelborg“ bezeichnet – etwas nordöstlich der „Pippelkolk“-Windung mit einer „Bergmühle“. Das passt zu den Angaben der Karte von 1721 und zu Kloppenburgs Überlieferungen. Adolf Flöckher kommentierte 1964 zu der Karte der Dammstadt, am „Pippelkolk“ habe eine 1480 angelegte Kupfermühle gelegen.5 Sie gab später dem „Kupferstrang“ seinen Namen; auf den alten Karten wird er noch als „Trillkefluß“ bezeichnet.
Die Karte der ehemaligen Dammstadt ist allerdings kein Beweis für die Existenz der Pippelburg: Die Zeichnung entstand gut 320 Jahre nach der Zerstörung der Dammstadt. Woher hatte der Zeichner sein Wissen? Hat er sich aufgrund mündlicher Überlieferungen mit Fantasie an die Arbeit gemacht? Und wo ist der „Pippelkolk“, der häufig bestätigt wird, heute zu finden?
Der Kupferstrang schlängelte sich in früheren Jahrhunderten gemächlich durch weite Wiesen bis nach Steuerwald – durch die Flussaue, in der etwas weiter östlich auch die Innerste sich wand. Zwischen 1834 und 1901 arbeitete man daran, den Kupferstrang an verschiedenen Stellen seines Verlaufs zu begradigen.6 1855 wurde nicht nur eine der Krümmungen des Baches beseitigt, sondern ein schnurgerader langer „Durchstich“ unterhalb der Bergmühle geplant.7 Längs der Maschstraße, die damals noch ein „Weg zu den angrenzenden Gärten und Wiesen“ war, entstand das Bachbett neu und schnitt die vielen Windungen des kleinen Flusses ab. Die Schleife mit dem „Pippelkolk“ wurde beseitigt und zugeschüttet. Sie liegt heute jenseits des begradigten Kupferstrangs unter dem Rex-Brauns-Sportplatz direkt an der B 1, etwa auf der Mitte zwischen der Tankstelle an der Bundesstraße und der Sporthalle. Der erste Abschnitt der Straße „Pippelsburg“, nach Osten verlängert, führt darauf zu.
Wenige Meter weiter in Richtung Norden, jenseits der B 1, strömt die Innerste und dahinter, mit gleichem Krümmungsbogen, folgt ein Bahndamm mit der Hafenbahn. Diese dreifache Barriere an der Grenze von Moritzberg – B 1, Fluss und Bahndamm – hat keinen natürlichen Ursprung. Noch vor 100 Jahren lief man hier von der Schützenwiese nach Himmelsthür durch weite ebene Wiesen in der Flussaue, duch das „Schuster Bleek“7. Die Innerste floss damals nicht so dicht am Fuß des Krehlabergs wie heute.

1851 bis 1853 entstand dort, wo die Innerste und der Kupferstrang sich auf Moritzberger Gebiet am nächsten kamen, die Fünf-Bogen-Brücke für die Eisenbahnlinie von Hildesheim nach Nordstemmen.8 Ab 1922 baute man zum Anschluss des neuen Hildesheimer Hafens die Hafenbahn. Um sie an die Bahnlinie nach Nordstemmen anzubinden, entstand der neue Bahndamm, der heute in weitem Bogen nach Süden den Pferdeanger umschließt. Um den Bahndamm bauen zu können, musste die Innerste angepasst werden: Sie wurde von der Schützenwiese bis zur Fünf-Bogen-Brücke in ein neues Flussbett entlang dem Hafenbahndamm geleitet. Vorher war sie quer durch den Pferdeanger geströmt.6 In den 1930er Jahren schließlich entstand der heutige Verlauf der B 1, die Bückebergstraße, wegen ihrer langen Bauzeit auch „Ewigkeitsweg“ genannt. Die B 1 folgte dem neuen Bogen der Innerste und der Hafenbahn. Moritzberg wurde dadurch an seiner nordöstlichen Grenze zur Sackgasse.
Zurück zur Pippelsburg: Beim Bau der Hafenbahn fand man laut Heinrich Kloppenburg behauene Quadersteine. Die hatte man auch schon 1721 und 1727 zwischen Kupferstrang und Innerste gefunden, im sogenannten „Bullenwinkel“ in den Wiesen zwischen Hildesheim und Moritzberg westlich der Lademühle. Damals wurden dort Ausgrabungen vorgenommen.1 Sie brachten Schutt, Mauerfundamente, Holzpfosten und steinerne Kugeln, Messingteile, Geschirr, einen Kamm aus Elfenbein, Tierknochen und Scherben zutage. „Diese Funde lassen über ihre Herkunft aus dem Mittelalter keinen Zweifel“, urteilte 1938 Bernhard Uhl9. Die Fundstücke waren zwar zu seiner Zeit schon spurlos verschwunden, doch wurden sie wie auch der Fundort in Aufzeichnungen genau beschrieben. Diese Aufzeichnungen sind im Stadtarchiv Hildesheim10 erhalten. „Der Schutt bestand aus Mauersteinen der verschiedensten Größe, Kalk und Gips. An der am weitesten nach Norden gelegenen Einschlagstelle wurden etwa vierzig behauene Quadersteine wechselnder Größe – etwa 1 – 2 Fuß in der Länge, 1 – 1 1/2 Fuß breit, 3/4 – 1 Fuß dick – zutage gefördert.“9 Eine „Perspektivische Zeichnunge nach dem Leben“ illustriert in den Aufzeichnungen aufs Feinste, wie die Pfähle aussahen, die man ausgrub.10
Uhl hielt die Grabungsfunde für die Reste eines „Wohnturms“ aus dem frühen Mittelalter, umgeben von einer Wehrmauer und erweitert durch einen Vorhof. „Die Wohntürme haben gewöhnlich einen Grundriß von 5 – 6 m im Quadrat, die in einiger Entfernung liegende Mauer eine Seitenlänge von 15 – 20 m. ... Ein Eingang zu ebener Erde fehlt regelmäßig; man gelangt in den Turm nur vermittels einer Leiter, die in ein paar Metern Höhe in eine Tür führt.“11
Zweifellos wurde im „Bullenwinkel“ eine kleine, aus Stein gebaute, befestigte Anlage gefunden – eine „Burg“, wenn man so sagen will. Wo lag sie? „Nach neueren Messungen etwa dort, wo die Eisenbahnbrücke den Boden von Moritzberg erreicht“, gab Gebauer 1922 an.12
Führt man die Angaben der Karten aus verschiedenen Jahrhunderten mit den maßstabsgetreuen Plänen des 20. Jahrhunderts zusammen, so findet man den Grabungsort im „Bullenwinkel“ dort, wo die Moritzberger Landschaft in den letzten 170 Jahren am heftigsten verändert wurde: mindestens drei Begradigungen des Kupferstrangs, ein neues Flussbett für die Innerste, der Bau der Bahnlinie nach Nordstemmen, der Hafenbahn und der Bundesstraße 1 und schließlich der Ausbau der B 1 in den 1970er Jahren. Hier wurde die Erde immer wieder umgeschichtet, kein Stein blieb auf dem anderen – ein Ort der totalen Veränderung, ein Verkehrsknotenpunkt.

Falls die Grabungen von 1721 und 1727 die Pippelsburg gefunden haben, dann lag sie kurz vor der Fünf-Bogen-Brücke zwischen dem Durchlass des Kupferstrangs unter der B 1 und der Hafenbahnlinie jenseits der Innerste – etwa 400 Meter vom „Pippelkolk“ entfernt, in der Verlängerung des Endabschnitts der Straße „Pippelsburg“ nach Norden.
Zwei Möglichkeiten gibt es also, die Pippelsburg anhand der bekannten geschichtlichen Quellen zu lokalisieren: Sie lag nordöstlich des „Pippelkolks“ im Bereich von Innerste / Hafenbahn / Pferdeanger – oder einige hundert Meter die B 1 entlang stadtauswärts im „Bullenwinkel“ am Knotenpunkt Kupferstrang / B 1 / Innerste / Hafenbahn. Der alte Fußweg von der Schützenwiese nach Himmelsthür verläuft übrigens auf allen genannten Karten durch beide möglichen Standorte, er verbindet sie.
Vielleicht hilft uns folgende Überlegung bei der Entscheidung weiter: Um 1400 umgab die Stadt Hildesheim ihr Gebiet mit einer Landwehr aus Zäunen, Hecken und Gräben. Vom Fuß des Krehlaberges verlief diese Landwehr durch die Innerstewiesen im Bereich des „Bullenwinkels“. An günstigen Stellen der Landwehr standen Beobachtungstürme zur Überwachung der umliegenden Landschaft.13 Der „Wohnturm“im „Bullenwinkel“, am Verkehrsknotenpunkt des 20. Jahrhunderts, könnte solch ein Wachturm gewesen sein – auch der straßenname „Hoher Turm“ in Himmelsthür kann sich auf solch einen Bau in der Innersteaue zwischen Moritzberg und Himmelsthür beziehen.13
Ein „Turm“ am Verkehrsknotenpunkt und eine „Meyen-“ oder„Pippelsburg“ am Pferdeanger? Die Frage wird sich durch Grabungen kaum noch klären lassen, denn im Bereich beider Standorte fließt heute die Innerste, verläuft die Hafenbahn, rollt der Verkehr auf der Bundesstraße 1.

Quellen
1 Bernhard Uhl: Eine alte Burganlage an der Innerste, in: Alt-Hildesheim, Heft 17, 1938
2 Nieders. Hauptstaatsarchiv Hannover, Best. 22g Hildesheim 14pk
3 Heinrich Kloppenburg: Geschichte des Moritzstiftes und der Gemeinde Moritzberg, maschinenschriftlich, Hildesheim 1933, S. 1346
4 Stadtarchiv Hildesheim, Best. 950 Nr. 218
5 Adolf Flöckher: Die Mühlen im Stadtbereich Hildesheim, in: Alt-Hildesheim, Heft 35, 1964
6 Adolf Flöckher: Die Innerste, in: Alt-Hildesheim, Heft 33, 1962
7 Nieders. Hauptstaatsarchiv Hannover, Best. Hann. 52, Nr. 2574, 1
8 Hildesheimer Volkshochschule e.V. (Hrsg.): Himmelsthür – Beiträge zur Geschichte, Hildesheim 1999, S. 230
9 Bernhard Uhl, 1938, S. 23
10 Stadtarchiv Hildesheim, Best. 100-91, Nr. 320, Bd. III
11 Bernhard Uhl, 1938, S. 24
12 Gebauer, J.: Geschichte der Stadt Hildesheim, Band I, Hildesheim 1922, S. 361
13 Hildesheimer Volkshochschule e.V. (Hrsg.) 1999, S. 42f
Zur Artikelübersicht
Moritzberger Neujahrsempfang