Der Verlag:

Unser Tipp:
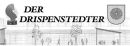
Unterstützer für die Webversion:

Anzeigenpreise für die Druckversion:
Anzeigenpreise
Moritzberger Ärzte
Denunziert, inhaftiert und gestorben
(sbr) Die Moritzberger Ärzte von damals – ein Thema für sich, stellte die Redaktion des „Moritz“ fest, nachdem sie in der Februarausgabe die Lebensgeschichte des jüdischen Arztes Dr. Leopold Cohn vorgestellt hatte. Ein kleiner Streifzug durch die – immer subjektiven – Zeitzeugenberichte stellt deshalb im Folgenden auch die Berufskollegen von Dr. Cohn vor. „Dr. Steinmann wäre nicht beliebt gewesen auf dem Moritzberge? Da muss ich nun wirklich ganz doll widersprechen“, meldete Ruth Steding aus der Beyerschen Burg zu Helga Buhtz‘ Bericht über „Frau Cohns Beerdigung“ an. „Dr. Steinmann war ein ganz feiner Mann. Mein Mann und ich waren in Behandlung bei ihm. Einen besseren Arzt gab es überhaupt nicht.“ Das Ehepaar Steding war Ende der 50er Jahre in Behandlung bei Dr. Steinmann im Bergsteinweg. Jener Dr. Steinmann in der Eulengasse, ein Zeitgenosse Dr. Cohns, hat mit dem jüngeren Dr. Steinmann nichts zu tun – „auch nicht verwandt“, stellte Dr. Gerhard Henze klar. „Der Dr. Steinmann in der Eulengasse war Militärarzt.“ Das Hildesheimer Adressbuch führt 1930 beide Ärzte auf: Sanitätsrat Dr. med. Franz Steinmann in der Eulenstraße und Dr. med. Franz Steinmann im Bergsteinweg 68 – auch noch gleiche Vornamen, dadurch steigt die Verwechslungsgefahr für die Nachwelt.

Friedrich Wippern aus dem Krummen Felde schrieb mit 96 Jahren seine Erinnerungen an die Moritzberger Ärzte auf. Er berichtet, Dr. Cohn habe schon Mitte der 1890er Jahre seine Praxis im Eckhaus Bergstraße / Königstraße eröffnet. „Da zu der Zeit auf dem Moritzberge ein älterer Arzt namens Dr. med. Steinmann in der Eulengasse praktizierte, fand der junge Arzt Dr. Cohn regen Zuspruch bei Krankheitsfällen.“ (1) Im April 1911, nach der Eingemeindung Moritzbergs, unterzeichneten beide Ärzte – Dr. Cohn und Dr. Steinmann der Ältere – zusammen mit anderen prominenten Moritzbergern einen Aufruf an die Bürger zur anstehenden Wahl der Bürgervorsteher. (1) In den 1920er Jahre begann die Entwicklung der Königstraße zur „Ärztestraße“. Zunächst eröffnete nach Anfangsjahren in der Bergstraße um 1926 Dr. Heinrich Lehne, der Vater des später dort praktizierenden Arztes Franz Lehne, seine Praxis. Eine Erinnerung von Inge Bierkandt beleuchtet die Vorzüge der frühen Motorisierung der Moritzberger Ärzte: „Das einzige Auto in der Königstraße, als wir im Winter 1928/29 hier einzogen, hatte Dr. Lehne. Es ist klar, der brauchte das auch. Er war so nett und großzügig und wir Kinder durften hinten immer mitfahren, wenn er Krankenbesuche machte. Das war für uns ganz toll! Wir waren aber auch sehr artig und saßen wie die Zinnsoldaten.“ Inge Bierkandt erzählte weiter: „Ich hatte eigentlich jedes Jahr im Winter eine Mandelentzündung, das war nun mal so. Dann hat man Fieber gehabt und ich durfte im Schlafzimmer meiner Eltern liegen, damit ich meine Schwester nicht ansteckte. Und wenn ich dann aus den Fieberträumen aufwachte und sah das Gesicht von Dr. Lehne vor mir, dann war ich schon halb gesund. Er war wirklich ein toller Arzt, humorvoll, sehr humorvoll.“ (2) Dann zog Dr. Max Topp, der Schwiegervater des später im selben Haus praktizierenden Dr. Hans Diesing, von der Goslarschen Straße in die Königstraße. Ezio de Lorenzo erzählte 1997: „Unser Hausarzt war seinerzeit – nach Dr. Cohn – Dr. Topp in der Königstraße. Dort soll sich Folgendes zugetragen haben: Dr. Topp hatte sich sehr abfällig über den Kriegszustand geäußert und in Gegenwart einer Frau (einer Patientin) seiner Erregung Lauf gelassen mit den Worten: ‚Wie soll ich mit 20 Liter Benzin Patienten besuchen, die krank sind?‘ Diese Äußerung hat eine Nachwirkung gehabt: Man hat ihn ins Gefängnis gebracht. Er saß mit meinem Vater zusammen im Gefängnis, das war Mitte November 1944. Mein Vater wurde am 19.11.44 ins Godehardi-Gefängnis eingeliefert. Und zwei Tage, drei Tage später haben wir erfahren, dass Dr. Topp ins Michaeliskloster überführt worden war. Das Michaeliskloster, das war eine Nervenanstalt – eine geschlossene, während die Sülte eine offene Anstalt war. Wer da (ins Michaeliskloster) reinkam, der war weg.“ Die „Eis-Onki“-Familie de Lorenzo hatte einen Mittelsmann, eine vertraute Person, die jeden zweiten Tag ein Esspaket zu Ezios Vater ins Gefängnis schmuggelte und ein paar Zeilen zurückbrachte, einen „Spickzettel“. „Insofern erfuhren wir dann auch, dass Dr. Topp vom Gefängnis ins Michaeliskloster gekommen war. Da ist er verstorben – und es war auch keine Annonce in der Zeitung, wir haben nur durch diese vertraute Person erfahren, dass Dr. Topp gestorben ist. Er muss im Dezember ‘44 oder Januar ’45 gestorben sein. Er war ein ruhiger, überlegener, großer Mensch. Er war seinerzeit im Alter meines Vaters, also so um 1880 geboren.“ (3) Nach dem Krieg übernahm Dr. Fritz Diesing, in der Zingel ausgebombt, für kurze Zeit die verwaiste Praxis von Dr. Topp. Sein Sohn Hans Diesing heiratete Dr. Topps Tochter und blieb ein halbes Jahrhundert lang als niedergelassener Arzt in der Königstraße. Quellen: (1) Moritzberg Archiv, Kultur und Geschichte vom Berge e.V., Bestand III, C 168 (2) Tonbandaufnahme, Moritzb. Erzählcafé am 22.2.2006, verschriftet v. Bärbel Rehberg, Moritzberg Verlag (3) Tonbandaufnahme v. 3.6.1997, verschriftet v. Sabine Brand, Moritzberg Verlag