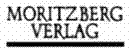Stadtteilzeitung Hildesheim West
Nr. 243 · November 2013
Wie geht es weiter im Steinberg
(sbr) Martin Levin, Forstamtsleiter in Göttingen, stellte Anfang September die
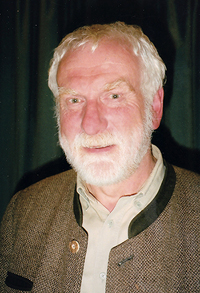 Forstamtsleiter Levin
naturnahe Bewirtschaftung des Göttinger Stadtwaldes vor. Dr. Fritz Griese und Revierförster Michael Eikemeier vom Forstamt Liebenburg erklärten drei Wochen später auf einem Rundgang durch den Steinberg ihre Wirtschaftsweise in den Hildesheimer Wäldern. Grund war der Wunsch von Moritzberger Bürgern und ihrem Ortsrat nach behutsamerem Umgang mit dem Waldbestand des Steinbergs.
Forstamtsleiter Levin
naturnahe Bewirtschaftung des Göttinger Stadtwaldes vor. Dr. Fritz Griese und Revierförster Michael Eikemeier vom Forstamt Liebenburg erklärten drei Wochen später auf einem Rundgang durch den Steinberg ihre Wirtschaftsweise in den Hildesheimer Wäldern. Grund war der Wunsch von Moritzberger Bürgern und ihrem Ortsrat nach behutsamerem Umgang mit dem Waldbestand des Steinbergs.
Martin Levin machte klar, dass der eigentliche Besitzer des Stadtwaldes der Bürger ist. Es gehe darum, die Wünsche der Bürger zu ermitteln: Naturschutz, Erholung, Infoarbeit, Holznutzung – so sah die Rangfolge der Ziele für die Waldnutzung in Göttingen aus. Grundsätzlich, so bestätigte Levin, ist Waldwirtschaft vereinbar mit Naturschutz. Grundsätzlich bringt das Prinzip des möglichst geringen Eingriffs in die Waldentwicklung auch wirtschaftliche Vorteile, grundsätzlich sei es das Beste, wenn die Stadt eigene Forstwirte hat.
Bäume werden in Göttingen schonend nur noch einzeln entnommen – mit möglichst geringem Einsatz von Technik. Es wird mit Rückegassen von 40 Metern Abstand gearbeitet, in Niedersachsen sind Abstände von 20 Metern üblich. „Waldboden ist kostbar“, betonte Levin. Im Göttinger Stadtwald werde er nur zu 8 Prozent befahren, in Niedersachsen können es durch die maximale Technisierung 25 Prozent sein. Lässt man die Bäume älter und dicker werden, ehe man sie „erntet“, wird die Ernte billiger. 60 bis 80 Bäume entnimmt das Forstamt Göttingen jährlich, in Hildesheim ist der „Hiebsatz“ höher.
„Es geht nicht um die Wirtschaftlichkeit“, war die Meinung einiger Zuhörer der gut besuchten Veranstaltung. „Es geht um den Umgang mit der Natur. Es geht um Mitlebewesen, über deren Leben und Tod rücksichtslos entschieden wird.“
 Waldrundgang mit Förster Michael Eikemeier
Die Beamten des Forstamtes Liebenburg erklärten Ende September vor Ort, wie sie arbeiten. 1985 wurde der Vertrag zwischen der Stadt und dem Forstamt zur Pflege und Bewirtschaftung des Hildesheimer Stadtwaldes unterzeichnet. Seit 1991 arbeiten die niedersächsischen Landesforsten nach dem LÖWE-Programm (Langfristige Ökologische Waldentwicklung).
Waldrundgang mit Förster Michael Eikemeier
Die Beamten des Forstamtes Liebenburg erklärten Ende September vor Ort, wie sie arbeiten. 1985 wurde der Vertrag zwischen der Stadt und dem Forstamt zur Pflege und Bewirtschaftung des Hildesheimer Stadtwaldes unterzeichnet. Seit 1991 arbeiten die niedersächsischen Landesforsten nach dem LÖWE-Programm (Langfristige Ökologische Waldentwicklung).
Das Forstamt Liebenburg ist Auftragnehmer der Stadt Hildesheim. In einem Zehn-Jahres-Plan, einem „Betriebswerk“, werden mit der Stadt die Ziele für den Holzeinschlag der kommenden Jahre festgelegt. Das Forstamt führt nach diesem Plan die Arbeiten durch, verkauft das eingeschlagene Holz und zieht die Kosten für seine Arbeiten ab. Durch die stark gestiegenen Holzpreise bleiben zur Zeit 80.000 bis 100.000 Euro Gewinn pro Jahr für die Stadt Hildesheim.
Griese und Eikemeier zeigten auf dem langen Spaziergang im Steinberg, wie sich der Wald auf natürliche Weise verjüngt. Sie verteidigten die flächenhaften Fällungen, die in den beiden letzten Wintern kritisiert worden waren. Es gehe darum, den Anteil an Nadelbäumen im Steinberg zu senken. Die Lichtungen, die durch die Durchforstung geschaffen wurden, seien notwendig, damit der in die Jahre gekommene Laubwald sich verjüngen könne.
Über das Alter, in dem die Bäume gefällt werden sollten, gehen die Vorstellungen in Liebenburg und Göttingen deutlich auseinander. Berücksichtigt man, dass erst ältere Bäume wertvolle Lebensräume für eine Vielfalt von Insekten und anderen Lebewesen bieten, so ist die „Hiebreife“ von 120 bis 160 Jahren zu früh angesetzt. Rotbuchen werden gut 300 Jahre alt und sind erst ab einem Alter von 200 Jahren besonders wertvoll für die Artenvielfalt, Eichen erreichen ein Alter von 500 bis 1000 Jahren.
Die Ziele des LÖWE-Programms und die Prinzipien der naturnahen Bewirtschaftung des Göttinger Stadtwaldes, so zeigt der Vergleich, sind nicht grundsätzlich verschieden. Die Umsetzung der Zielsetzungen wird jedoch unterschiedlich konsequent angegangen. Biologisch alter Wald kann zur Zeit im Hildesheimer Raum nicht entstehen. Der erste Schritt zur Verbesserung der Situation für die Hildesheimer Wälder läge darin, die Einschlagmengen in Übereinstimmung mit der Stadt herabzusetzen. Die Bürger können Einfluss auf das nächste Zehn-Jahres-Betriebswerk nehmen. „Dafür bieten sich 2014 und 2015 gute Möglichkeiten“, erläuterte Eikemeier, „dann wird die Inventur für das neue Betriebswerk gemacht, der neue Plan tritt 2017 in Kraft.“
Das Berghölzchen wird nicht mehr wirtschaftlich genutzt, sondern nur noch gepflegt. Eine Perspektive wäre, auch im Steínberg die Erntemaschinen nicht mehr einzusetzen und auf Naturwaldbewirtschaftung umzusteigen. Eberhard Johl hat einen entsprechenden Vorschlag bereits für den nächsten „Bürgerhaushalt“ der Stadt eingebracht. Die Entscheidung darüber liegt letztlich beim Stadtrat.
Ein spannendes neues Kapitel könnte dann beginnen: die Entwicklung der Wälder um Hildesheim bei minimalen Eingriffen in den Naturhaushalt. Martin Levin warf in seinem Vortrag Fragen dazu auf: „Wie haben die Urwälder denn funktioniert? Wie wäre es mit dem Zuwachs, wenn die Walddecke geschlossen ist? Was will der Wald eigentlich?“ – Das sind spannende Fragen nach dem Gleichgewicht, auf das die Natur hinarbeitet, nach dem, was nicht die Menschen, sondern die „Mitlebewesen“ wollen.
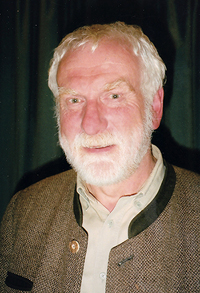 Forstamtsleiter Levin
Forstamtsleiter LevinFotos (2): sbr
Martin Levin machte klar, dass der eigentliche Besitzer des Stadtwaldes der Bürger ist. Es gehe darum, die Wünsche der Bürger zu ermitteln: Naturschutz, Erholung, Infoarbeit, Holznutzung – so sah die Rangfolge der Ziele für die Waldnutzung in Göttingen aus. Grundsätzlich, so bestätigte Levin, ist Waldwirtschaft vereinbar mit Naturschutz. Grundsätzlich bringt das Prinzip des möglichst geringen Eingriffs in die Waldentwicklung auch wirtschaftliche Vorteile, grundsätzlich sei es das Beste, wenn die Stadt eigene Forstwirte hat.
Bäume werden in Göttingen schonend nur noch einzeln entnommen – mit möglichst geringem Einsatz von Technik. Es wird mit Rückegassen von 40 Metern Abstand gearbeitet, in Niedersachsen sind Abstände von 20 Metern üblich. „Waldboden ist kostbar“, betonte Levin. Im Göttinger Stadtwald werde er nur zu 8 Prozent befahren, in Niedersachsen können es durch die maximale Technisierung 25 Prozent sein. Lässt man die Bäume älter und dicker werden, ehe man sie „erntet“, wird die Ernte billiger. 60 bis 80 Bäume entnimmt das Forstamt Göttingen jährlich, in Hildesheim ist der „Hiebsatz“ höher.
„Es geht nicht um die Wirtschaftlichkeit“, war die Meinung einiger Zuhörer der gut besuchten Veranstaltung. „Es geht um den Umgang mit der Natur. Es geht um Mitlebewesen, über deren Leben und Tod rücksichtslos entschieden wird.“
 Waldrundgang mit Förster Michael Eikemeier
Waldrundgang mit Förster Michael EikemeierDas Forstamt Liebenburg ist Auftragnehmer der Stadt Hildesheim. In einem Zehn-Jahres-Plan, einem „Betriebswerk“, werden mit der Stadt die Ziele für den Holzeinschlag der kommenden Jahre festgelegt. Das Forstamt führt nach diesem Plan die Arbeiten durch, verkauft das eingeschlagene Holz und zieht die Kosten für seine Arbeiten ab. Durch die stark gestiegenen Holzpreise bleiben zur Zeit 80.000 bis 100.000 Euro Gewinn pro Jahr für die Stadt Hildesheim.
Griese und Eikemeier zeigten auf dem langen Spaziergang im Steinberg, wie sich der Wald auf natürliche Weise verjüngt. Sie verteidigten die flächenhaften Fällungen, die in den beiden letzten Wintern kritisiert worden waren. Es gehe darum, den Anteil an Nadelbäumen im Steinberg zu senken. Die Lichtungen, die durch die Durchforstung geschaffen wurden, seien notwendig, damit der in die Jahre gekommene Laubwald sich verjüngen könne.
Über das Alter, in dem die Bäume gefällt werden sollten, gehen die Vorstellungen in Liebenburg und Göttingen deutlich auseinander. Berücksichtigt man, dass erst ältere Bäume wertvolle Lebensräume für eine Vielfalt von Insekten und anderen Lebewesen bieten, so ist die „Hiebreife“ von 120 bis 160 Jahren zu früh angesetzt. Rotbuchen werden gut 300 Jahre alt und sind erst ab einem Alter von 200 Jahren besonders wertvoll für die Artenvielfalt, Eichen erreichen ein Alter von 500 bis 1000 Jahren.
Die Ziele des LÖWE-Programms und die Prinzipien der naturnahen Bewirtschaftung des Göttinger Stadtwaldes, so zeigt der Vergleich, sind nicht grundsätzlich verschieden. Die Umsetzung der Zielsetzungen wird jedoch unterschiedlich konsequent angegangen. Biologisch alter Wald kann zur Zeit im Hildesheimer Raum nicht entstehen. Der erste Schritt zur Verbesserung der Situation für die Hildesheimer Wälder läge darin, die Einschlagmengen in Übereinstimmung mit der Stadt herabzusetzen. Die Bürger können Einfluss auf das nächste Zehn-Jahres-Betriebswerk nehmen. „Dafür bieten sich 2014 und 2015 gute Möglichkeiten“, erläuterte Eikemeier, „dann wird die Inventur für das neue Betriebswerk gemacht, der neue Plan tritt 2017 in Kraft.“
Das Berghölzchen wird nicht mehr wirtschaftlich genutzt, sondern nur noch gepflegt. Eine Perspektive wäre, auch im Steínberg die Erntemaschinen nicht mehr einzusetzen und auf Naturwaldbewirtschaftung umzusteigen. Eberhard Johl hat einen entsprechenden Vorschlag bereits für den nächsten „Bürgerhaushalt“ der Stadt eingebracht. Die Entscheidung darüber liegt letztlich beim Stadtrat.
Ein spannendes neues Kapitel könnte dann beginnen: die Entwicklung der Wälder um Hildesheim bei minimalen Eingriffen in den Naturhaushalt. Martin Levin warf in seinem Vortrag Fragen dazu auf: „Wie haben die Urwälder denn funktioniert? Wie wäre es mit dem Zuwachs, wenn die Walddecke geschlossen ist? Was will der Wald eigentlich?“ – Das sind spannende Fragen nach dem Gleichgewicht, auf das die Natur hinarbeitet, nach dem, was nicht die Menschen, sondern die „Mitlebewesen“ wollen.