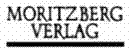Stadtteilzeitung Hildesheim West
Nr. 236 · März 2013
Der Steinberg
Nicht Nutzforst, sondern „Bürgerpark“
(sbr) Der Steinberg, der Galgenberg und der größere Teil des Berghölzchens waren früher Gemeinheits-Weideland, durchsetzt mit Steinbrüchen. Dieses Land gehörte nicht einem Grundeigentümer, sondern wurde nach alten Gewohnheiten und Rechten von verschiedenen Gemeinden für das Vieh genutzt. Dadurch waren die Höhenzüge in Stadtnähe kahl gefressen – gegen die vielen Weidetiere kam kein Baum an. Nach der „Gemeinheitsteilung“ Mitte des 19. Jahrhunderts begann die Stadt mit der Aufforstung der Flächen, die ihr zugefallen waren, denn die Viehhaltung ging stark zurück.

Eberhard Johl und Ortsbürgermeister Erhard Paasch vor dem Denkmal für Oberförster August Brauns (1815 – 1899), der den Steinberg vor 150 Jahren als Wald bepflanzen ließ
Mit etwa 50 verschiedenen Baumarten und einer großen Vielfalt an Sträuchern ließ Oberförster August Brauns ab 1862 im Auftrag der Stadt den Steinberg bepflanzen – er sollte Erholungsgebiet für die Stadtbevölkerung werden, deshalb die sorgfältige Planung als Mischwald. Kaum eine Holzart wachse in Deutschland, von der nicht ein Stämmchen im Steinberg gepflanzt sei, berichtete die Gerstenbergsche Zeitung 1866. Die Aufforstung dauerte 25 Jahre lang und kostete damals fast 40.000 Mark.
Gustav Struckmann, Hildesheimer Oberbürgermeister von 1875 bis 1909, legt in seinen Lebenserinnerungen sehr anschaulich dar, was denn den Unterschied zwischen einem Wald weit ab von der Stadt und einem in Stadtnähe ausmacht. Steinberg und Bergholz, erklärt er, „waren von vorne herein nicht als eigentliche nutzbringende Forst gedacht, sondern sollten, wozu sie sich bei ihrer Entfernung von nur etwa 20 Minuten von der Stadt und bei den herrlichen Aussichten ... vorzüglich eigneten, der Bürgerschaft vorzugsweise als eine Art Bürgerpark, Promenade und Erholungsort dienen“. Deshalb sei auf beiden Bergzügen eine Wirtschaft und auf dem Steinberg auch noch eine Aussichtshalle angelegt worden. „Und darauf mußte die forstliche Bewirtschaftung auch eine feinere, nicht streng an die für Nutzforsten geltenden forsttechnischen Regeln sich haltende sein.“(S. 305)
Struckmann richtete deshalb die Stelle eines städtischen Forstbeamten im mittleren Dienst ein, der hauptamtlich für die Verwaltung der Hildesheimer Wälder eingestellt war und durch einen Forstmeister der Königlichen Regierung fachlich beaufsichtigt wurde. Diesem Forstbeamten zur Seite gestellt wurde die städtische „Land- und Forstkommission“, „welche nach Aufstellung des jährlichen Forsthaushaltsplanes durch den Forstverwalter eine gemeinschaftliche Besichtigung aller Forsten ... vornahm, wobei der Plan erläutert wurde“. Bei wichtigen Angelegenheiten musste diese Kommission aus Verwaltungs- und Stadtratsmitgliedern, dem Forstverwalter sowie „einigen sachverständigen Bürgern“ angehört werden.
Mit „viel Vergnügen“ erinnert sich Struckmann an diese jährlichen „lehrreichen“ Forstgänge, an deren Ende, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag durch den Hildesheimer Wald gegangen war, ein gemeinsames Picknick stand mit „in der Asche eines Holzfeuers gebratenen duftigen Kartoffeln, die allen vortrefflich schmeckten und in großen Mengen verzehrt wurden.“ (S. 308) Dieser gemeinsame Gang mit fachkundiger Begleitung hat sehr zur Wertschätzung der Hildesheimer Wälder beigetragen haben. Gewisse Aufgaben wie das Aufstellen von Bänken, von Gedenksteinen und Denkmälern übernahm der von Struckmann ins Leben gerufene „Verschönerungsverein“.
Forstverwalter auf der neu geschaffenen Stelle wurde Friedrich Achilles, Schwiegersohn des Oberförsters Braun, in dessen Amtszeit der Steinberg bepflanzt worden war. Wöchentlich musste Achilles dem Oberbürgermeister im Rathaus mündlich Bericht erstatten über „das Vorgekommene oder Beabsichtigte“ in den Hildesheimer Wäldern. Struckmann erinnert sich: „Es sind unter seiner Leitung die Waldungen gut gediehen, namentlich ... die des Bergholzes und Steinbergs zu schönen schattigen Waldungen herangewachsen, so daß die Städter in unmittelbarer Nähe der Stadt erfrischende Waldluft genießen können, wovon außerordentlich viel Gebrauch gemacht wird.“ (S. 309)
„Für Hildesheim sind diese bewaldeten Höhen, welche mehr und mehr durch Baumpflanzungen in unmittelbarer Verbindung mit der Stadt gesetzt sind, von unschätzbarem Werte. Der Reinertrag war freilich, Alles in Allem genommen, aus den vorgedachten Gründen bislang kein sehr erheblicher ...“ (S. 309)

Eberhard Johl und Ortsbürgermeister Erhard Paasch vor dem Denkmal für Oberförster August Brauns (1815 – 1899), der den Steinberg vor 150 Jahren als Wald bepflanzen ließ
Foto: sbr
Gustav Struckmann, Hildesheimer Oberbürgermeister von 1875 bis 1909, legt in seinen Lebenserinnerungen sehr anschaulich dar, was denn den Unterschied zwischen einem Wald weit ab von der Stadt und einem in Stadtnähe ausmacht. Steinberg und Bergholz, erklärt er, „waren von vorne herein nicht als eigentliche nutzbringende Forst gedacht, sondern sollten, wozu sie sich bei ihrer Entfernung von nur etwa 20 Minuten von der Stadt und bei den herrlichen Aussichten ... vorzüglich eigneten, der Bürgerschaft vorzugsweise als eine Art Bürgerpark, Promenade und Erholungsort dienen“. Deshalb sei auf beiden Bergzügen eine Wirtschaft und auf dem Steinberg auch noch eine Aussichtshalle angelegt worden. „Und darauf mußte die forstliche Bewirtschaftung auch eine feinere, nicht streng an die für Nutzforsten geltenden forsttechnischen Regeln sich haltende sein.“(S. 305)
Struckmann richtete deshalb die Stelle eines städtischen Forstbeamten im mittleren Dienst ein, der hauptamtlich für die Verwaltung der Hildesheimer Wälder eingestellt war und durch einen Forstmeister der Königlichen Regierung fachlich beaufsichtigt wurde. Diesem Forstbeamten zur Seite gestellt wurde die städtische „Land- und Forstkommission“, „welche nach Aufstellung des jährlichen Forsthaushaltsplanes durch den Forstverwalter eine gemeinschaftliche Besichtigung aller Forsten ... vornahm, wobei der Plan erläutert wurde“. Bei wichtigen Angelegenheiten musste diese Kommission aus Verwaltungs- und Stadtratsmitgliedern, dem Forstverwalter sowie „einigen sachverständigen Bürgern“ angehört werden.
Mit „viel Vergnügen“ erinnert sich Struckmann an diese jährlichen „lehrreichen“ Forstgänge, an deren Ende, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag durch den Hildesheimer Wald gegangen war, ein gemeinsames Picknick stand mit „in der Asche eines Holzfeuers gebratenen duftigen Kartoffeln, die allen vortrefflich schmeckten und in großen Mengen verzehrt wurden.“ (S. 308) Dieser gemeinsame Gang mit fachkundiger Begleitung hat sehr zur Wertschätzung der Hildesheimer Wälder beigetragen haben. Gewisse Aufgaben wie das Aufstellen von Bänken, von Gedenksteinen und Denkmälern übernahm der von Struckmann ins Leben gerufene „Verschönerungsverein“.
Forstverwalter auf der neu geschaffenen Stelle wurde Friedrich Achilles, Schwiegersohn des Oberförsters Braun, in dessen Amtszeit der Steinberg bepflanzt worden war. Wöchentlich musste Achilles dem Oberbürgermeister im Rathaus mündlich Bericht erstatten über „das Vorgekommene oder Beabsichtigte“ in den Hildesheimer Wäldern. Struckmann erinnert sich: „Es sind unter seiner Leitung die Waldungen gut gediehen, namentlich ... die des Bergholzes und Steinbergs zu schönen schattigen Waldungen herangewachsen, so daß die Städter in unmittelbarer Nähe der Stadt erfrischende Waldluft genießen können, wovon außerordentlich viel Gebrauch gemacht wird.“ (S. 309)
„Für Hildesheim sind diese bewaldeten Höhen, welche mehr und mehr durch Baumpflanzungen in unmittelbarer Verbindung mit der Stadt gesetzt sind, von unschätzbarem Werte. Der Reinertrag war freilich, Alles in Allem genommen, aus den vorgedachten Gründen bislang kein sehr erheblicher ...“ (S. 309)
Quellen
· Jutta Finke: Die Gedenksteine im Steinberg, Moritz vom Berge Nr. 17, Oktober 1991
· Lebenserinnerungen von Oberbürgermeister Dr. Gustav Struckmann, bearbeitet von
Silke Lesemann, Hildesheim 1991
· Jutta Finke: Die Gedenksteine im Steinberg, Moritz vom Berge Nr. 17, Oktober 1991
· Lebenserinnerungen von Oberbürgermeister Dr. Gustav Struckmann, bearbeitet von
Silke Lesemann, Hildesheim 1991