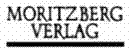Stadtteilzeitung Hildesheim West
Nr. 248 · Mai 2014
„Demokratie geht anders“
(sbr) … das ist das Fazit des Protestes gegen die Abholzung im Godehardipark – ein Vorwurf, der über die Schäden in der Natur durch die „Grünpflege“ der Stadt noch hinausgeht. Jetzt geht es um Schäden im sozialen Umgang miteinander, der Vorwurf von Herrschaft und Willkür steckt dahinter, von Ignoranz gegenüber den Wünschen und Bedürfnissen der Bewohner. Das ist eine Folge von Wiederholungen immer desselben „brachialen“ Umgangs mit der Natur in den Stadtteilen – trotz Protesten, trotz Versicherungen, nun würde alles besser, trotz Einstellung neuer Fachkräfte. Seit 2011 schreitet die Zerstörung der öffentlichen Grünflächen so hartnäckig voran, dass der Bürger System dahinter vermutet.
 Auf den Stock gesetzt in 2012 und in 2014 (nächste Bild)
„Bürger, schützt eure Anlagen“ titelte Moritz vom Berge im Oktober 2011. Städtische Mitarbeiter hatten begonnen, die Heckensträucher an der Himmelsthürer Straße herauszureißen. „Nur an den Straßeneinmündungen“, hieß es damals, denn dort sei die Sicht durch die Büsche behindert. Einige Anwohner übernahmen ein Stück Randstreifen, pflanzten neu. Die anderen Heckenreste werden jedes Jahr wieder – und jedes Jahr noch ein Stück niedriger – mit Maschineneinsatz abgehackt. Das sieht schlimm aus und hat unangenehme Folgen: Das Platanenlaub wird nicht mehr vom Gebüsch eingefangen, grünes Kraut sprießt höher als die Buschstoppeln, Verpackungsmüll dazwischen – was ursprünglich ein Straßenschmuck war, wird zum Müllstreifen. „Das sieht doch nicht schön aus“, sagt der Verantwortliche, nachdem die ehemalige Hecke zwei Jahre so geschreddert wurde. Noch ein Jahr später, im Herbst 2014, sollen die Reste der Hecken zwischen den Platanen nun ganz vernichtet werden.
Auf den Stock gesetzt in 2012 und in 2014 (nächste Bild)
„Bürger, schützt eure Anlagen“ titelte Moritz vom Berge im Oktober 2011. Städtische Mitarbeiter hatten begonnen, die Heckensträucher an der Himmelsthürer Straße herauszureißen. „Nur an den Straßeneinmündungen“, hieß es damals, denn dort sei die Sicht durch die Büsche behindert. Einige Anwohner übernahmen ein Stück Randstreifen, pflanzten neu. Die anderen Heckenreste werden jedes Jahr wieder – und jedes Jahr noch ein Stück niedriger – mit Maschineneinsatz abgehackt. Das sieht schlimm aus und hat unangenehme Folgen: Das Platanenlaub wird nicht mehr vom Gebüsch eingefangen, grünes Kraut sprießt höher als die Buschstoppeln, Verpackungsmüll dazwischen – was ursprünglich ein Straßenschmuck war, wird zum Müllstreifen. „Das sieht doch nicht schön aus“, sagt der Verantwortliche, nachdem die ehemalige Hecke zwei Jahre so geschreddert wurde. Noch ein Jahr später, im Herbst 2014, sollen die Reste der Hecken zwischen den Platanen nun ganz vernichtet werden.

Ähnlich folgenschwere „Grünpflege“ ist in der Bennoburg zu beobachten: Zwischen dieser schönen schattigen Straße und dem Spazierweg längs dem Blänkebach wuchsen seit vielen Jahrzehnten aufgelockert Büsche, dort stehen Sitzbänke, dort hielten sich jede Menge Vögel, Eichhörnchen, selbst ein Graureiher auf. Das Grün wirkte gepflegt, weil hier ausgewachsene formschöne Büsche standen. Postkarten zeigen den Weg durch die Grünanlage mit Blick auf St. Mauritius. – In 2012 kam der „Pflegeschnitt“: die Büsche werden „auf den Stock gesetzt“. „Erst einmal Ordnung reinbringen“, sagte Fachbereichsleiter Heinz Habenicht im Interview mit Moritz vom Berge. „Das wächst wieder nach, das braucht dann so schnell nicht wieder gemacht zu werden.“
Von wegen – im Januar 2014 ist alles frisch, zum Teil noch tiefer, beschnitten. Jetzt sind weniger einzelne Schnittflächen von dicken Ästen zu besichtigen, sondern viele Haufen stoppelige Ästchen und Zweiglein, Stoppelfelder stellenweise – dazwischen und drumherum, weil nun viel mehr Licht einfällt, jede Menge grünes Kraut, Brennesseln und die Waldrebe vom Rottsberg. Sie erobert sich die wüsten Flächen im Nu, niemand gräbt sie aus. Durch Schneiden wird sie wunderbar angeregt. Junge Triebe, die aus den Gebüsch-Stoppeln sprießen, werden in Windeseile von ihr überwuchert und erstickt. Der kleine Park sieht nicht mehr gut aus, reizt nicht zum Spazierengang – bald wird der Rat kommen, alles endgültig wegzumachen. Steppenlandschaft am Spielplatz selbst im Frühling – das Efeu verschwindet, statt dessen Lianen der Waldrebe
„Demokratie geht anders“ – das eine Übel im Umgang mit den Bürgern ist die (Verzögerungs-)Taktik, mit der drei Jahre lang hingehalten wurde. Am Schluss ist das ursprüngliche Ziel – alle Büsche weg – doch erreicht. Eine andere Taktik kommt gleichzeitig zum Einsatz: Ängste wecken, sachlich falsche (Schutz)behauptungen machen, Erklärungen geben, die keine sind. Die Liste ist lang: Hinter Büschen würden sich Täter verstecken (Bennoburg); Zweige könnten Kindern in die Augen stechen (Godehardikamp); Büsche würden dem Boden so viele Nährstoffe entziehen, dass er öfters teuer ausgetauscht werden muss (Pressestelle der Stadt Oktober 2011); es wäre billiger, überall Rasen einzusäen statt Büsche wachsen zu lassen; die früheren Mitarbeiter des Gartenamtes, die die vielen Büsche gepflanzt haben, hätten keine Ahnung gehabt. Auch diese (Verdummungs-)Taktik zerstört Vertrauen – spätestens nach einigen Jahren spürt jeder Bürger, was dahinter steckt.
Steppenlandschaft am Spielplatz selbst im Frühling – das Efeu verschwindet, statt dessen Lianen der Waldrebe
„Demokratie geht anders“ – das eine Übel im Umgang mit den Bürgern ist die (Verzögerungs-)Taktik, mit der drei Jahre lang hingehalten wurde. Am Schluss ist das ursprüngliche Ziel – alle Büsche weg – doch erreicht. Eine andere Taktik kommt gleichzeitig zum Einsatz: Ängste wecken, sachlich falsche (Schutz)behauptungen machen, Erklärungen geben, die keine sind. Die Liste ist lang: Hinter Büschen würden sich Täter verstecken (Bennoburg); Zweige könnten Kindern in die Augen stechen (Godehardikamp); Büsche würden dem Boden so viele Nährstoffe entziehen, dass er öfters teuer ausgetauscht werden muss (Pressestelle der Stadt Oktober 2011); es wäre billiger, überall Rasen einzusäen statt Büsche wachsen zu lassen; die früheren Mitarbeiter des Gartenamtes, die die vielen Büsche gepflanzt haben, hätten keine Ahnung gehabt. Auch diese (Verdummungs-)Taktik zerstört Vertrauen – spätestens nach einigen Jahren spürt jeder Bürger, was dahinter steckt.
Der Schaden für den Naturhaushalt in den Stadtteilen ist groß, der Vertrauensschaden bei den Anwohnern ist enorm. Wo liegt das Problem für die Stadt? Einzugestehen, dass man zu kurz gedacht hat – dass die Folgekosten vergessen wurden? Der zunehmende „Dreck“ durch Baumlaub und Müll an den Straßenrändern, seit keine Büsche sie einfangen? Das sprießende Grünkraut und der Hundekot auf den „frei“ gemachten Flächen? Der Kummer der Anwohner über den Schwund von Natur in der Wohnumgebung? Zunehmender Lärm, vermehrter Feinstaub, abnehmende Luftfeuchtigkeit, das immer schlechtere Klima in den Straßen?
Eine Fehlinvestition müsste eingestanden werden: Die beiden Superrasenmäher zu je 99.000 Euro, die 2010 angeschafft wurden, und der weitere städtische Fuhrpark fordern Einsatz. Sie sind beliebte Männerspielzeuge, aber viel zu mächtig für kleine Parks und Straßenbegleitgrün. Diese Maschinen pflegen nicht, sie zerstören: Igel und Vogelnester, Büsche und Bäumchen, das Stadtbild und die Zufriedenheit der Bewohner.
Sollte noch ein anderer Grund hinter dem Zerhacken der Büsche stehen? Wird mit dem Gehäcksel so viel Geld verdient, dass die Zerstörung lockt? Wo, wenn nicht im Heizkraftwerk der EVI, wie Heinz Habenicht versichert, landet denn das Buschwerk? Wohin wird es verkauft? Wo liegen die abgeholzten Berge? Werden sie der Natur zurückgegeben, kompostiert? Fragen über Fragen, die eine Stadtverwaltung klären muss, um Vertrauen zurückzugewinnen.
 Auf den Stock gesetzt in 2012 und in 2014 (nächste Bild)
Auf den Stock gesetzt in 2012 und in 2014 (nächste Bild)
Fotos (3): sbr

Ähnlich folgenschwere „Grünpflege“ ist in der Bennoburg zu beobachten: Zwischen dieser schönen schattigen Straße und dem Spazierweg längs dem Blänkebach wuchsen seit vielen Jahrzehnten aufgelockert Büsche, dort stehen Sitzbänke, dort hielten sich jede Menge Vögel, Eichhörnchen, selbst ein Graureiher auf. Das Grün wirkte gepflegt, weil hier ausgewachsene formschöne Büsche standen. Postkarten zeigen den Weg durch die Grünanlage mit Blick auf St. Mauritius. – In 2012 kam der „Pflegeschnitt“: die Büsche werden „auf den Stock gesetzt“. „Erst einmal Ordnung reinbringen“, sagte Fachbereichsleiter Heinz Habenicht im Interview mit Moritz vom Berge. „Das wächst wieder nach, das braucht dann so schnell nicht wieder gemacht zu werden.“
Von wegen – im Januar 2014 ist alles frisch, zum Teil noch tiefer, beschnitten. Jetzt sind weniger einzelne Schnittflächen von dicken Ästen zu besichtigen, sondern viele Haufen stoppelige Ästchen und Zweiglein, Stoppelfelder stellenweise – dazwischen und drumherum, weil nun viel mehr Licht einfällt, jede Menge grünes Kraut, Brennesseln und die Waldrebe vom Rottsberg. Sie erobert sich die wüsten Flächen im Nu, niemand gräbt sie aus. Durch Schneiden wird sie wunderbar angeregt. Junge Triebe, die aus den Gebüsch-Stoppeln sprießen, werden in Windeseile von ihr überwuchert und erstickt. Der kleine Park sieht nicht mehr gut aus, reizt nicht zum Spazierengang – bald wird der Rat kommen, alles endgültig wegzumachen.
 Steppenlandschaft am Spielplatz selbst im Frühling – das Efeu verschwindet, statt dessen Lianen der Waldrebe
Steppenlandschaft am Spielplatz selbst im Frühling – das Efeu verschwindet, statt dessen Lianen der WaldrebeDer Schaden für den Naturhaushalt in den Stadtteilen ist groß, der Vertrauensschaden bei den Anwohnern ist enorm. Wo liegt das Problem für die Stadt? Einzugestehen, dass man zu kurz gedacht hat – dass die Folgekosten vergessen wurden? Der zunehmende „Dreck“ durch Baumlaub und Müll an den Straßenrändern, seit keine Büsche sie einfangen? Das sprießende Grünkraut und der Hundekot auf den „frei“ gemachten Flächen? Der Kummer der Anwohner über den Schwund von Natur in der Wohnumgebung? Zunehmender Lärm, vermehrter Feinstaub, abnehmende Luftfeuchtigkeit, das immer schlechtere Klima in den Straßen?
Eine Fehlinvestition müsste eingestanden werden: Die beiden Superrasenmäher zu je 99.000 Euro, die 2010 angeschafft wurden, und der weitere städtische Fuhrpark fordern Einsatz. Sie sind beliebte Männerspielzeuge, aber viel zu mächtig für kleine Parks und Straßenbegleitgrün. Diese Maschinen pflegen nicht, sie zerstören: Igel und Vogelnester, Büsche und Bäumchen, das Stadtbild und die Zufriedenheit der Bewohner.
Sollte noch ein anderer Grund hinter dem Zerhacken der Büsche stehen? Wird mit dem Gehäcksel so viel Geld verdient, dass die Zerstörung lockt? Wo, wenn nicht im Heizkraftwerk der EVI, wie Heinz Habenicht versichert, landet denn das Buschwerk? Wohin wird es verkauft? Wo liegen die abgeholzten Berge? Werden sie der Natur zurückgegeben, kompostiert? Fragen über Fragen, die eine Stadtverwaltung klären muss, um Vertrauen zurückzugewinnen.